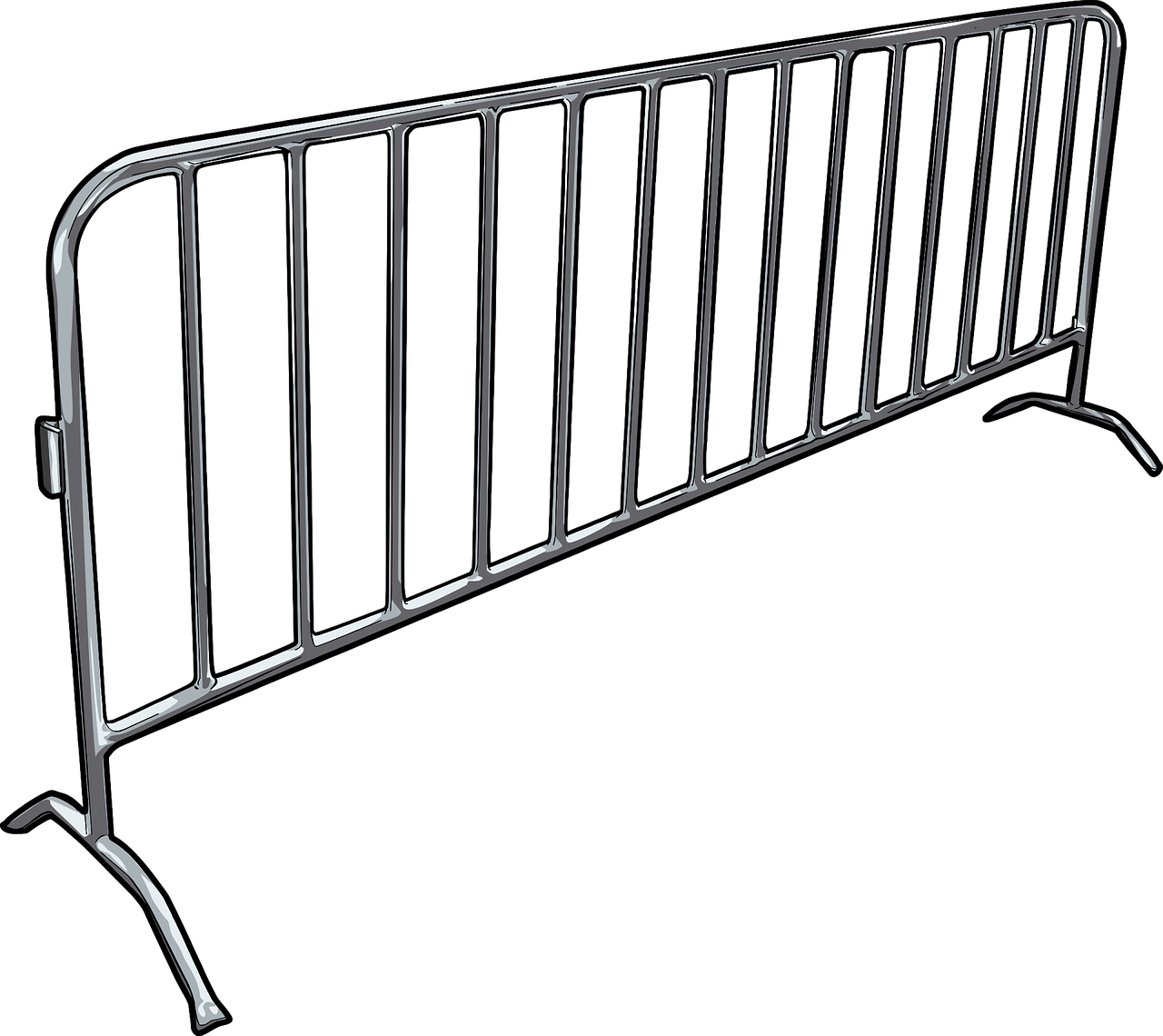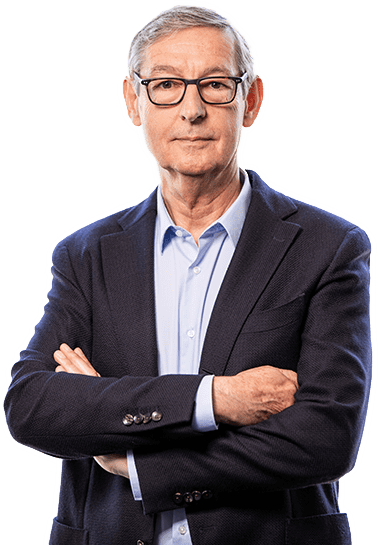Am vergangenen Freitag hat das Obergericht Zürich einen Fluglotsen freigesprochen, der wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs angeklagt war. Behandelt wurde ein Vorfall aus dem Jahre 2012 bei dem es auf dem Flughafen Zürich zu einer ungewollten Annäherung zweier Flugzeuge gekommen war. Das Obergericht folgte in seiner Argumentation einem Bundesgerichtsentscheid von 2019 in welchem dieses in einem ähnlichen Fall einen Fluglotsen freisprach. Als Grund wurde beide Male angeführt, dass der Tatbestand eines Gefährdungsdelikts nur bei Vorhandensein einer konkreten Gefahr erfüllt sei. Hypothetische Gefährdungsmöglichkeiten seien nicht zu berücksichtigen.
Dass sich das Zürcher Obergericht nun am besagten Bundesgerichtsurteil ausrichtet, lässt aufhorchen. Setzt sich mit diesem Urteil eine neue Betrachtungsweise solcher und ähnlicher Fälle durch? Kann von einer neuen Gerichtspraxis gesprochen werden? Was immer auch die Zukunft weisen wird, es lohnt sich bestimmt, das nun zum zweiten Mal eingeschlagene Vorgehen der Justiz genauer zu betrachten.
Sicherheitskonzepte verhindern den Eintritt des Risikos
Bis anhin wurden die vom Gericht zu beurteilenden Ereignisse ausschliesslich aus der Perspektive der Fehlbarkeit des angeklagten Individuums angegangen. Unweigerlich kam dabei die Frage der Fahrlässigkeit ins Zentrum der Betrachtung. Das führte dazu, dass sich die Rechtspflege auf ihrem Heim-Turf zu Hause befand. Ob es bei den Fällen auch tatsächlich eine Gefährdung gab, wurde nicht diskutiert, sondern stillschweigend hingenommen; besser gesagt von der Anklage einfach übernommen. Dass die Gerichte in den letzten zwei Fällen der von der Staatsanwaltschaft ins Spiel gebrachten oberflächlichen Betrachtung widerstanden haben, ist ein Novum. Endlich setzt sich die Justiz mit den Abläufen und Prinzipien auseinander, die in einer High Reliability Organisation (HRO) zur Anwendung kommen, um Sicherheit zu gewährleisten. Diese Grundsätze sind darauf ausgerichtet, die mit den Tätigkeiten der Organisation verbundenen Risiken unter Kontrolle zu bringen. Dazu werden diverse unterschiedliche Barrieren in die Abläufe eingebaut, die es den stets vorhandenen Gefahren nicht erlauben ‘durchzuschlagen’. Sie verhindern den Eintritt des Risikos und führen dazu, dass die Gefährdung von Leben, Material oder Umwelt nicht stattfindet. Nebst den technischen Sicherheitssystemen spielt der Mensch in diesem Konzept der vielen Hindernisse eine entscheidende Rolle. Er selbst ist eine solche Barriere und trägt in den allermeisten Fällen dazu bei, dass die Gefahren abgewandt werden können. Für die Professionals in den HRO’s wird diese Tätigkeit nicht als Auftrag verstanden, sondern als Berufung im eigentlichen Sinne des Wortes.
Die Wirkung technischer Sicherheitssysteme muss berücksichtigt werden.
Viele Profis, die in hoch technisierten Arbeitsumfeldern mit komplexen Systemen zu tun haben, werden heute durch technische Sicherheitssysteme unterstützt. Diese Systeme schränken menschliches Handeln insofern ein, als dass sie Auswirkungen nicht zulassen, die zu unerwünschten Resultaten oder potenziellen Gefahren führen könnten. Das können einfache Warnfunktionen sein oder hoch entwickelte Schutzsysteme, die es bspw. In modernen Cockpits dem Piloten verunmöglichen, eine vordefinierte aerodynamische Enveloppe des Flugzeugs mit unangemessenen Steuerausschlägen zu verlassen. Auch wenn er wollte, er könnte die Maschine nicht ins Trudeln bringen. So wird die menschliche Handlungsfreiheit mit technischen Hilfsmitteln eingeschränkt. Was vom arbeitenden Menschen als Beschneidung seiner Ursächlichkeit empfunden wird, ist effektiv aber dazu da, ihn vor seiner eigenen Fehlbarkeit zu schützen. Solche Sicherheitssysteme verhindern, dass menschliches Tun sich zu einer konkreten Gefahr entwickelt.
Die Diskussion zeigt, dass mit der von den Gerichten nun eingeschlagenen Praxis solche Schutzmechanismen bei der Schuldfrage neu zwingen berücksichtigt werden müssen. Denn sie verhindern das Zustandekommen einer konkreten Gefahr. Viele dieser Sicherheitssysteme wurden von Behörden zertifiziert. Sie haben in oft aufwendigen Prüfverfahren den Beweis antreten müssen, dass bei richtigem Funktionieren keine Gefahr entsteht. Aus dieser Sicht ist es bedauerlich, dass das Bundesgericht noch im September 2019 einen Fluglotsen verurteilte, der für eine, wie es die Staatsanwaltschaft nannte, gefährliche Annäherung zweier Flugzeuge in einer Luftstrasse verantwortlich war. Seiner nur hypothetisch gefährlichen Anweisung an die von ihm geführte Flugzeugbesatzung wurde zwar initial folgegeleistet, jedoch durch ein Sicherheitssystem in der abschliessenden Ausführung verhindert. In diesem Fall warnte das Anti-Kollisionswarngerät vor einer gefährlichen Annäherung, die Piloten griffen ein und entschärften die Situation. Die Gefahr ist dank dem Warnsystem in Tat und Wahrheit nie eingetreten, der Tatbestand der Gefährdung war nicht gegeben. Trotzdem wurde der Lotse 2019 noch verurteilt.
Die unhaltbare ‘Sonderlösung Schweiz’
In der Schweiz ist es der Staatsanwalt erlaubt, die Berichte der unfalluntersuchenden Behörde (SUST) entgegen deren Zweckbestimmung für ihre anklagende Tätigkeit zu benutzen. Gemäss Aussagen der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland, die für den Flughafen Zürich zuständig ist, werden die Berichte der Unfall-Untersuchungsstelle systematisch gelesen. Dass bei diesem Scanning diejenigen Vorfälle hervorstechen, die von der SUST als gefährlich eingestuft wurden, ist naheliegend. Im erwähnten Fall der Annäherung zweiter Flugzeuge in der Luftstrasse ordnete sie die Begebenheit in die Vorfall-Kategorie A ein (Risk of collision. The risk classification of an aircraft proximity in which serious risk of collision has existed"). Dies obwohl wie dargelegt, nie eine konkrete Gefahr bestanden hat. Es stellen sich somit zwei Fragen. Wäre es in Anbetracht der neuen Bewertung der Gerichte nicht angezeigt, dass sich die SUST mit der Kategorisierung der unversuchten Vorfälle auseinandersetzt? Oder würde es Sinn machen, dass, wie das andere Staaten auch tun, die Schuldfrage mit einer durch die Justiz geführte eigenständige Untersuchung geklärt wird. Die Schweizer Praxis ist stossend, denn sie führt für an Vorfällen Beteiligte zusammen mit der geltenden Meldepflicht zur Selbstanzeige.
Wenn normale Abläufe zu Ereignissen aufgebauscht werden
Im aktuellen Fall, welcher das Obergericht Zürich beurteilen musste, war die Startfreigabe für die Passagiermaschine auf der Piste 28 bei gleichzeitigem Schulungsbetrieb eines Kleinflugzeuges auf Piste 16 eine normale Angelegenheit, die einen unbeabsichtigten Verlauf nahm. Durch die korrigierenden Eingriffe des Fluglotsen und das professionell richtige Ausführen der angewiesenen Flugmanöver der Fluglehrerin im Schulflugzeug war die Situation unter Kontrolle. Die Barrieren haben ihre Wirkung entfaltet. Die Gefährdung kam nie zustande. Wenn die Staatsanwaltschaft aus dieser Begebenheit eine düstere Gefahrengeschichte baut, stelle sich die Frage, ob sie Aufsehen erregen will oder ob es ihr nicht gelingt, das Wirken eines Sicherheitskonzeptes zu verstehen.
Fazit
Die Beurteilung des Gerichts, dass keine Gefährdung vorlag, ist eine Honorierung der vielfältigen Anstrengungen, die im ‘System Luftfahrt’ unternommen werden, um die Sicherheit zu garantieren. Damit wird hoffentlich eine Ära eingeläutet, die den Blick frei macht und uns hilft, neue Wege zu gehen. Wege, die nicht dazu führen, dass wir einen nicht beabsichtigten Verlauf eines Ereignisses postum als Fehler eines Individuums verstehen. Wege, die einer konstruierten Anschuldigung die argumentative Basis entziehen.