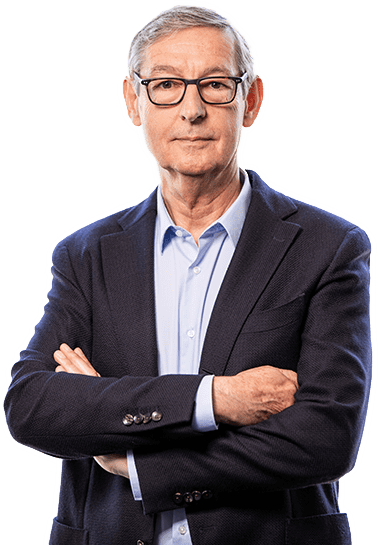Wenn wir heute aus Unfällen lernen müssen, ist das der Tatbeweis für das Scheitern des Sicherheitsmanagements mit all seinen Komponenten. Der soeben publik gewordene Abschlussbericht der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST deckt diesen Umstand in aller Deutlichkeit auf. Er zeigt eindrücklich, dass das direkt-ursächliche menschliche Versagen im offenkundigen Zusammenhang mit anderem steht. Mit der Überforderung der Betreibergesellschaft, die Risiken unter organisatorischer Kontrolle zu halten und mit den Grenzen des Konzepts der Regulation und der behördlichen Aufsicht. Der Unfall war organisatorisch aufgelegt.
Der Absturz der Ju Air vom 4. August 2018 ist eine unsägliche Tragödie. Nach dem Erscheinen des Berichts der SUST ist es nicht nur dies, sondern ebenso eine niederschmetternde Enttäuschung. Eine bittere Ernüchterung darüber, dass es in der Schweizer Luftfahrt nach den schweren Unfällen zu Beginn des Jahrtausends wieder zu einem Versagen des Gesamtkonzeptes des Sicherheitsmanagements mit all seinen Komponenten gekommen ist. Zu diesen zählen in der Luftfahrt ein gesetzlich vorgeschriebenes Safety Management System (SMS) auf der Stufe des Unternehmens sowie die Komponenten ‘Gesetzgebung’ und ‘Behördliche Aufsicht’. Der SUST-Bericht durchleuchtet das Ganze mit einem Anspruch auf eine ganzheitliche Betrachtung und zeigt auf, wie alle auf ihre Weise versagt haben.
Wie bei jedem Unfall besteht die Verlockung darin, das Problem nur bei den direkt-ursächlich Beteiligten zu sehen. Dies mündet dann in Schlagzeilen wie: «Pilotenfehler führen zum Ju 52- Absturz». Sie vermitteln ein verführerisches Narrativ. Die Schuldigen sind gefunden und damit kann zur Tagesordnung zurückgekehrt werden. Das Erliegen dieser Verlockung hat grosse Vorteile. Sie entbehrt uns vor der Debatte über die dahinterliegende Komplexität und macht uns so das Leben einfacher. Sie kann ebenso Verantwortungsträger und oder Unternehmen vor einer unangenehmen Auseinandersetzung schützen. Beides lässt der SUST Bericht nicht zu – und das ist gut so. Er zeichnet sich durch eine tief greifende Analyse aus, die sich nicht mit der direkten Ursachenfindung zufriedengibt. Seine systemische Betrachtungsweise enthüllt den unappetitlichen Kontext, der den Nährboden für den Unfall gebildet hat. Dabei beschönigt er in keiner Weise die direkten Ursachen, die wie immer beim fehlbaren Menschen zu finden sind. Weil sich die SUST ausschliesslich mit dem Unfall beschäftigen kann, bleibt aber vieles nicht gesagt, was den Flugbetrieb der Ju Air in den letzten vielen Jahren ebenso geprägt hat. In Tausenden von Flugstunden hat ihre Mannschaft dafür gesorgt, dass unzählige risikoreiche Situationen sicher gemeistert wurden. Historische Fliegerei ist nicht zu vergleichen mit einem industriell geschliffenen Airline-Betrieb. So verlangt sie bspw. von ihren Kapitänen immer wieder die volle Ausnützung ihrer Entscheidungskompetenz. Es gab bestimmt viele Begebenheiten, in denen sie weiter gehen mussten als das, was vorgegeben war, um die Sicherheit des Fluges sicherstellen zu können. Der Eindruck, der in jedem Unfallbericht entsteht, dass der Mensch ein Risikofaktor darstellt, greift zu kurz. Meistens ist er ein Sicherheitsfaktor erster Güte. Dies gesagt, entbindet es ihn nicht davon, sich kritisch mit sich selbst und mit den gruppendynamischen Phänomenen auseinanderzusetzen, welche leider auch ins Abseits führen können. Der durch den Marschhalt gegebene Raum lässt sich nutzen, um nicht nur diese Thematik zu vertiefen, sondern sich ebenfalls den systemischen Aspekten zu widmen.
Das Sicherheitsmanagement der Ju-Air
Die SUST hält fest, dass das Risikomanagement des Flugbetriebsunternehmens nicht in der Lage war, die während des Betriebes auftretenden Mängel und Risiken sowie die häufig begangenen Regelbrüche seiner Flugbesatzungen zu erkennen bzw. zu verhindern. Dazu beigetragen haben Verstösse gegen die Meldepflicht durch Bordkommandanten. Weder der Safety Manager noch der Compliance Monitoring Manager waren in der Lage, ihren gesetzlich vorgegebenen Rollen gerecht zu werden. Ganz offensichtlich hat der Dialog zwischen diesen zwei Sicherheitsbeauftragten und den Verantwortungs- und damit Risikoträgern nicht funktioniert. Zudem wurden im Bereich Compliance Monitoring gesetzliche Normen, die für Ju-Air tatsächlich anwendbar waren, für nicht anwendbar erklärt. Das System 'Check and Balance', welches gesetzlich vorgegeben ist und ein wichtiger Pfeiler in jedem Sicherheitsmanagement darstellt, wurde von der Betreibergesellschaft nicht richtig praktiziert.
Im Zusammenhang mit der Sicherheitskultur weist die SUST nach, dass es zu einem regelrechten ‘Drift into Failure’ gekommen ist. Das direkt für den Unfall ursächliche Verhalten der Cockpitcrew des Unfallflugs bestand gemäss der SUST darin, in zu geringer Höhe und ohne Möglichkeit für einen alternativen Flugweg ins enge Tal mit zu tiefe Fluggeschwindigkeit eingeflogen zu sein. Der Bericht zeigt auf, dass es bei Ju-Air gängige Praxis und damit Teil der Kultur war, tief über Landschaften und Kreten und nahe an Felswänden zu fliegen. Diese Gewohnheit führte dazu, dass beim Unfallflug die mit dem unsachgemässen Einfliegen in den Talkessel verbundenen Risiken wahrscheinlich von der Crew nicht mehr adäquat wahrgenommen wurden. Zudem hat es die erwähnte Angewohnheit dem ‘Pilot Monitoring’ beim möglichen Erkennen der Gefahr erschwert, seinen mit dem Steuern der Maschine beschäftigten Kollegen darauf aufmerksam zu machen. Auch ist davon auszugehen, dass die spektakulären, aber teilweise regelwidrigen Flugwege von den Passagieren als attraktiv empfunden wurden und sich die Crews dadurch in ihren Entscheidungen bestärkt gefühlt haben. Diese Gewohnheiten waren gemäss Bericht derart gut verankert, dass nicht einmal die Regel- und Best Practice-Widrigkeit Grund genug war, um angesprochen zu werden. Es ist dies ein schlagender Beweis dafür, dass die Kultur einen viel grösseren Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeitenden hat als Vorgaben, Regeln und Gesetze. Die Bedeutung der Sicherheitskultur kann nicht genügend hervorgehoben werden. Sie zu etablieren und kontinuierlich zu nähren, ist eine der zielführendsten Managementaufgaben in einer Unternehmung, die grosse Risiken unter organisatorischer Kontrolle haben muss. Der SUST Bericht enthält unzählige Sicherheitsempfehlungen und Sicherheitshinweise, die auf eine Verbesserung der Kultur bei der Betreibergesellschaft hindeuten. Sie veranschaulichen in ihrer Form aber den Umstand, dass es schwierig ist, Sicherheitskultur zu regulieren und damit überprüfbar zu machen. Dem Leser wird klar, was die Communitiy schon weiss: Die weitere Verbesserung der Sicherheit muss mit einem verstärkten Fokus auf die Sicherheitskultur vorangetrieben werden. Unterlassungen der Unternehmensführung im sicherheitskulturellen Bereich werden nicht geahndet. Sie sind im unternehmerischen Risiko subsumiert. Doch von der moralischen Verpflichtung wird deswegen kein Verantwortungsträger entbunden.
Regulation und behördliche Aufsicht
Liest man die im Bericht aufgelisteten Sicherheitsempfehlungen und Sicherheitshinweise, die sich an die Aufsichtsbehörde BAZL richten, so wird klar, dass es nebst den vielen behördlichen Mängeln nicht nur um diese geht. Ebenso problematisch ist der Umstand, dass es keine wirklich taugliche Regulation für Betreiber in der Art der Ju-Air gibt. Dieser Umstand führt zwangsläufig zu Zielkonflikten bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie versucht, eine Regulation, die auf grosse Operator zugeschnitten ist, für einen Sonderling zu interpretieren. Doch das hat sie versucht. Wie sich zeigt, ist dieser Ansatz nicht ohne Konsequenzen geblieben. Der etwas krampfhaft anmutende Approach des BAZL, den europäischen Richtlinien der EASA (European Union Aviation Safety Agency) gerecht zu werden, war also offensichtlich dem Nichtvorhandensein einer eigentlichen Oldtimer-Regulation, bestimmt aber auch seiner, im Bericht erwähnten, mangelnden Kompetenz in Sachen Vintage-Aviation geschuldet. Das Resultat war eine Flucht in Formalismen.
Aufgrund von Aussagen im Bericht kann angenommen werden, dass sich das BAZL in seiner Rolle als Aufsichtsbehörde, vielleicht manchmal auch aus Wohlwollen, in gewissen Aspekten auf die Äste hinausbegeben hat. Doch wie sich nun zeigt, wurde die Ju-Air dem damit verbundenen Vertrauen nicht wirklich gerecht. Es war wohl eine Überforderung der kleinen Organisation. Statt diese Überforderung offen anzugehen, wurden die falschen Rückschlüsse gezogen. Es etablierte sich das Narrativ in der Organisation, das vom Regulator handelt, dem es nicht gelingt, für die spezifische Operation eine brauchbare Aufsicht zu gestalten. Gemäss diesem Narrativ verlor und verstrickte sich das Amt in Bürokratie und Formalismen. So wurde Aufsicht schlechtgeredet und verlor so die ihr zustehende Bedeutung für das Sicherheitsmanagement. Es ist eine Tragik in sich, dass es beiden, der Aufsichtsbehörde und der Ju-Air nicht gelungen ist, diesen Knoten zu lösen. Für die Zukunft der historischen Fliegerei in der Schweiz ist eine Lösung aber von entscheidender Bedeutung.
Was fehlte?
Der Bericht der SUST macht deutlich was wirklich fehlte, um den Unfall zu verhindern: ein unabhängiger Blick auf das alle Komponenten umfassende Management der Sicherheit. Die Untersuchungsbehörde hat ihn. Leider kommt sie nur beim schweren Vorfall oder Unfall ins Spiel. Der vorliegende Bericht zeigt, dass das heutige Konzept grosse Mängel hat, welche sich allein nicht mit der Schwäche der einzelnen Glieder in der Kette erklären lassen. So kämpft jeder Stakeholder mit den Problemen, die inhärent mit seiner Rolle verbunden sind. Der Regulator, welcher nicht wirklich klarkommt mit der Unterschiedlichkeit und Grösse der Flugbetriebe. Die Aufsichtsbehörde, die nicht nur die Schwierigkeit hat, die Kompetenz für die Vielfalt der Betriebsvarianten der Flugunternehmen zu gewährleisten, sondern auch grosse Mühe bekundet, das starre Regelwerk sinngemäss zu interpretieren. Die Betreibergesellschaft, die wie im Falle der Ju-Air einen gangbaren Weg zwischen Enthusiasmus und professionellem Flugbetrieb finden muss. Die Besatzungen, die im Umgang mit den vielfältigen Varianten der menschlichen Fehlbarkeit gefordert bleiben. Es fehlt im Alltag jemand, der sich anbahnende systemische Fehlentwicklungen erkennt, nicht an eine operative Rolle gebunden ist und der eine Unabhängigkeit besitzt, wie sie die SUST hat. Letztere sollten wir uns für schwere Vorfälle aufsparen. Das heutige Sicherheitsmanagement ist in der Luftfahrt so weit entwickelt, dass der reaktive Teil der Vor- und Unfalluntersuchung an Bedeutung verloren hat. Es benötigt mit anderen Worten keine Unfälle mehr, um besser zu werden. Vielmehr ginge es darum, das heutige Wissen adäquat anzuwenden. Damit wäre schon viel getan.