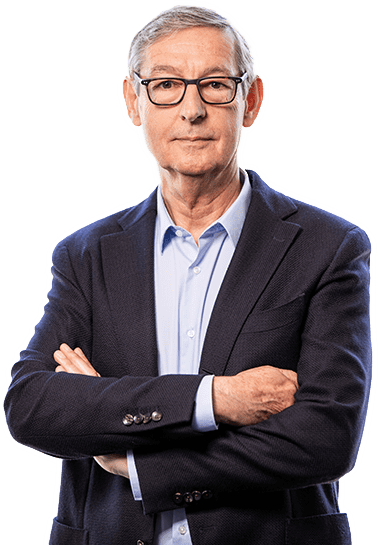Zweckentfremdung von Berichten der unabhängigen Untersuchungsstelle
Wenn sich schwerwiegende Vor- oder gar Unfälle von Luftfahrzeugen, Bahnen und oder Schiffen ereignen, so hat die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) den Auftrag, diese als unabhängige Behörde zu untersuchen. Bei diesen Untersuchungen geht es nicht nur darum, die unmittelbaren Ursachen solcher Ereignisse zu ermitteln, sondern auch deren tieferliegende Gründe aufzudecken. Die Untersuchungen haben zum ausschliesslichen Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen künftige Unfälle und Gefahrensituationen verhütet werden können. Die Ergebnisse der Sicherheitsuntersuchungen dürfen nicht der Klärung von Schuld- und Haftungsfragen dienen. Daher wird in jedem Bericht des SUST in der Präambel darauf hingewiesen, dass wenn der Bericht zu anderen Zwecken als zur Unfallverhütung verwendet würde, diesem Umstand gebührend Rechnung zu tragen sei.
Kommt es im Zusammenhang von schweren Vorfällen oder Unfällen zu Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, so stützt sich diese auch auf die Berichte der SUST. Es ist gängige Praxis, dass diese systematisch gelesen werden, um festzustellen, ob ein dringender Tatverdacht vorliegt und eine Strafuntersuchung angezeigt ist. Dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft führt zu einer Zweckentfremdung der SUST-Berichte und relativiert, wie wir später sehen werden, deren Aussagekraft.
Wir haben es mit einer befremdlichen Situation zu tun. Derselbe Staat, der mit einer speziellen Behörde die Gründe von Vor- und Unfällen aufzudecken versucht, mit dem erklärten Ziel der Verbesserung der Sicherheit lässt es zu, dass eben diese Berichte zweckentfremdet werden, indem sie für die Klärung der Schuldfrage beigezogen werden. Sämtlichen an Vor- und Unfällen Beteiligten sind diese Zusammenhänge bekannt. Das inkohärente Verhalten des Staats bringt sie in einen schweren Zielkonflikt. Sie müssen davon ausgehen, dass Aussagen, die sie im Rahmen der Sicherheitsuntersuchung machen, in der Strafverfolgung später gegen sie verwendet werden. Schwer ist der Zielkonflikt deshalb, weil sie als betroffene Berufsleute und Experten das grösste Interesse daran haben, dass die Ursachenfindung erfolgreich ausgeht und dass die Sicherheit verbessert werden kann. In Anbetracht einer möglichen Bestrafung ist es aber mehr als verständlich, wenn sie sich in diesem Zielkonflikt für den Schutz der eigenen Person entscheiden.
Es ist offensichtlich, dass die geltenden gesetzlichen Regelungen überdacht und angepasst werden müssen, um diesem zusammenhangslosen Handeln des Staats ein Ende zu setzen. Entsprechende Änderungsvorschläge liegen in Bern auf. Das Parlament und die Regierung sind aufgerufen, sich damit auseinanderzusetzen. Die Sicherheit der Öffentlichkeit wird ihnen dankbar sein dafür.
Selbstanklage
In der Luftfahrt auferlegt der Staat Schlüsselpersonen eine Meldepflicht. Sicherheitsrelevante Vorkommnisse, von denen sie Kenntnis haben, müssen zwingend den Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Damit verfolgt der Staat das Ziel, die Sicherheit zu verbessern, indem aus Fehlern gelernt werden kann. Nun gibt es Fälle, bei denen Vorkommnisse, die auf Grund solcher Meldungen bekannt wurden, eine Strafuntersuchung zur Folge hatten und bei denen die Meldeperson am Ende bestraft wurde. Auch in diesem Beispiel handelt der Staat inkohärent. Seine Regelungen können meldepflichtige Schlüsselpersonen zur Selbstanklage zwingen. Das ist eine nicht haltbare Situation in einem Rechtsstaat. Zudem weiss der Staat nicht, was für ihn wichtiger ist. Die Erhöhung der Sicherheit, die er mit der Meldepflicht zu erreichen, oder die juristisch richtige Anwendung des Strafgesetzes, die er mit der Strafuntersuchung umzusetzen versucht. Da er im Rahmen der gültigen Verfahren nie in die Lage kommt, diese Güterabwägung im konkreten Fall machen zu müssen und auch niemanden beauftragt hat, diese Abwägung vorzunehmen, erfolgt sie unsystematisch und erratisch und wird dem Zufall überlassen. Damit ist es nicht klar, ob es dem Staat überhaupt ein Anliegen ist, dass diese Güterabwägung gemacht wird. So stellt sich die berechtigte Frage, was Passagiere, die hier die Öffentlichkeit repräsentieren und die in Kenntnis dieser Umstände wären, wohl dazu sagen würden.
Das fehlende Verfahren
Es ist unbestritten sinnvoll, dass schwere Vorfälle und Unfälle im Hinblick auf eine Verbesserung der Sicherheit als auch juristisch zur Klärung der Schuldfrage untersucht werden. Was aber fehlt und was die heutigen gesetzlichen Regelungen nicht zulassen, ist ein Verfahren, welches es in einem frühen Stadium der Untersuchungen ermöglichen würde, interdisziplinär zu klären, ob im vorliegenden Fall die Übernahme der Verantwortung und damit die mögliche Bestrafung oder das Lernen und damit die Verbesserung der Sicherheit für die Gesellschaft bedeutungsvoller ist. Für eine solche Klärung ist der Einbezug von Fachexperten beider Lager von besonderer Bedeutung. Diese Fachgremien wären von Staates wegen beauftragt, für ein Gleichgewicht zwischen Lernen und Bestrafung, zwischen Verantwortungsübernahme und Sicherheit zu sorgen.
Es kann nicht sein, dass wir diese für die Gesellschaft so wichtige Entscheidung nicht interdisziplinär aushandeln. Es darf nicht sein, dass das korrekte Abwickeln der juristischen Verfahren zur Klärung der Schuldfrage per se über dem Anliegen der Öffentlichkeit nach Sicherheit steht. Es wird heute stillschweigend hingenommen und unreflektiert angenommen, dass die Klärung der Schuldfrage eine Verbesserung der Sicherheit bewirkt. Dem liegt eine problematische Denke zugrunde, die davon ausgeht, dass Strafe die Experten und Mitarbeiter an der Front dazu bringt, sicherer zu handeln. Würden wir im einundzwanzigsten Jahrhundert dieses Paradigma noch in der Schule anwenden, würden wir von «schwarzer Pädagogik» sprechen. Wir müssen heute aber mit Staatsanwälten leben, die dieses überholte Paradigma in Interviews als moralisch gerechtfertigte Grundlage ihres Handelns verteidigen. Da wird erklärt, dass die Akteure an der Front, denen es bewusst ist, dass sie für Fehlhandlungen bestraft werden können, aufmerksamer zu Werke gehen. Die Strafe erhöht ihrer Meinung nach nicht nur die Aufmerksamkeit und Konzentration, sondern sie sorgt für ein Unrechtsbewusstsein und für eine Schärfung des Geistes. So wörtlich zitiert. Diese Aussagen sind gekoppelt an eine Überzeugung, das Strafverfahren eine präventive Wirkung haben und es wird angenommen, dass dadurch die Sicherheit positiv beeinflusst wird.
Es fällt schwer, solche Aussagen zu kommentieren. Letztlich aber können sie nur als grobe Unterstellung an Fachleute gewertet werden, deren oberste Priorität die Wahrung der öffentlichen Sicherheit ist. Sie lassen erkennen, dass sie aus einem Verständnis heraus formuliert werden, welches die Umstände, in denen an der Front gearbeitet wird, nicht berücksichtigen. Und dass die Komplexität der heutigen Systeme mit ihren Fehlanreizen und Ungereimtheiten in keiner Weise gewürdigt wird. Sie ist Ausdruck einer verengten Optik, die ausschliesslich das Individuum im Blick hat. Es ist eine überholte Perspektive, die der heutigen Realität nicht gerecht wird.
Fazit
Wenn wir glauben, dass wir in der heutigen Welt unseren Wunsch nach Sicherheit allein an die Akteure an der Front delegieren können, dann liegen wir falsch. Wir brauchen ein Verständnis, welches das Wirken der Menschen in komplexen Systemen umfasst. Dazu brauchen wir für die Aufarbeitung von schweren Vorfällen und Unfällen ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren, welches uns erlaubt, bei eben dieser Aufarbeitung das Individuum und das System im Blick zu behalten. Und wir benötigen ein kohärentes Handeln des Staates, welches die Zweckentfremdung von Berichten, die ausschliesslich für die Verbesserung der Sicherheit gedacht sind, verbietet und das die unwürdige Selbstanzeige abschafft.