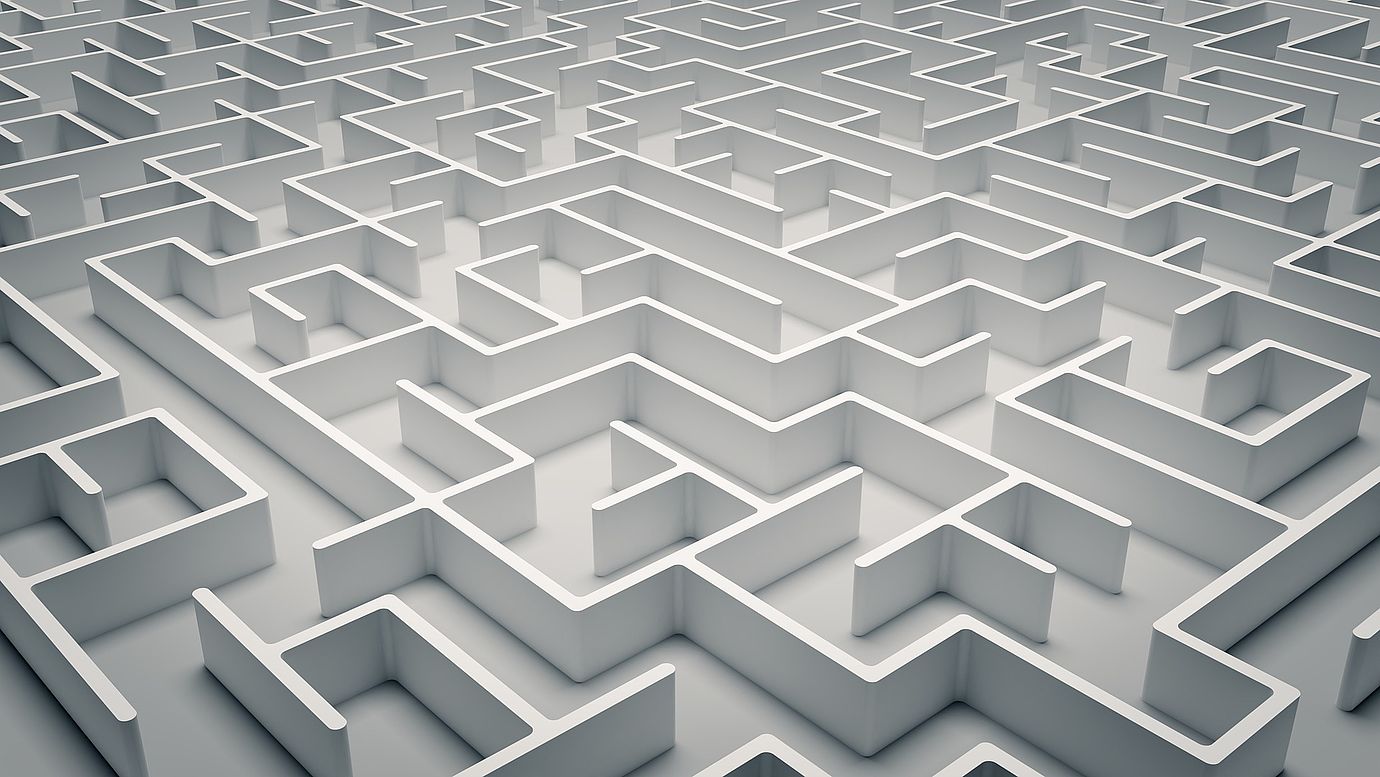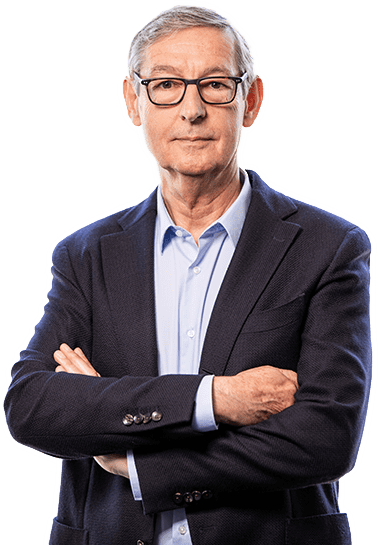Vor zwei Wochen in das Festnetz in der Schweiz während acht Stunden weitestgehend zusammengebrochen. Davon betroffen waren auch die Notrufnummern. Das Unternehmen Swisscom schaffte es damit wieder in die Schlagzeilen. Ähnliche Systemversagen, bei denen der nationale Telecom-Serviceprovider nicht die beste Figur machte, liegen nämlich nicht allzu lange zurück. Da ausgerechnet in einer Nacht mit schweren Unwettern die Notrufnummern ausgefallen waren, war das Medienecho entsprechend gross. So mache ich im Nachgang zu den Ereignissen in einem Interview mit dem CEO der Swisscom eine interessante Beobachtung. Ein Journalist fragt ihn, ob es in Anbetracht der Schwere des Vorfalles und der Häufung ähnlicher Vorkommnisse nicht an der Zeit wäre zurückzutreten.
Ein Rücktritt käme für den CEO einer herben Strafe gleich. Er würde so zwar die Verantwortung für das Vorgefallene übernehmen. Doch was wäre damit erreicht? Die Nation hätte einen Sündenbock und sie ginge mit der Illusion, dass das Problem behoben sei, wieder zurück in den ‘courant normale’. Fall erledigt. Interessanterweise tut sie das, obwohl sie ausser der Bestätigung eines fragwürdigen Gerechtigkeitsempfindens genau weiss, dass das Problem nicht gelöst ist.
Die Frage mit Aufforderungscharakter des Journalisten ist nachvollziehbar. Sie kommt aus dem weitverbreiteten und gut verankerten Fehler-Schuld Paradigma. Wer Fehler macht, muss für sie geradestehen, die Konsequenzen tragen, die Schuld auf sich nehmen. Dies im irrigen Glauben, dass damit Gerechtigkeit hergestellt wird und dass der offensichtlich inkompetente Verantwortungsträger durch jemanden abgelöst wird, der es besser kann.
Gehen wir der Sache auf den Grund und prüfen wir das Fehler-Schuld-Paradigma auf seine Tauglichkeit.
Was hat sich zugetragen?
Swisscom führte bei einem Netzelement einer Telefonie-Plattform für Geschäftskunden Wartungsarbeiten durch. Ein Software-Update verursachte ein Fehlverhalten, das einen Dominoeffekt auslöste. Dadurch wurden weite Teile des Netzes von der Störung betroffen. Die Behebung der Panne dauerte deshalb so lange, weil dazu der Lieferant der Netzwerkkomponente beigezogen werden musste. Zum besseren Verständnis gilt es zu erwähnen, dass es in der Schweiz keine Systemführerschaft beim Notruf gibt. So erklärt der CEO im Interview, dass beim Notrufsystem zahlreiche Partner involviert seien. Es gleiche einer Maschine mit 1000 Zahnrädern: Swisscom kontrolliere davon vielleicht 700, auf die restlichen 300 habe die Firma nur beschränkten oder keinerlei Einfluss. Alle diese Zahnräder müssten aber ineinandergreifen. Andernfalls funktioniere der Notruf nicht mehr.
Ohne im Detail zu wissen, was sich konkret abgespielt hat, können wir uns auf die Verkettung der Umstände gedanklich einlassen. Es ist äusserst selten, dass Mitarbeitende der Wartung mit der Absicht ans Werk gehen, eine Panne zu produzieren. Ebenso unwahrscheinlich ist vorsätzliches Fehlprogrammieren von Update-Software. Wir dürfen bestimmt davon ausgehen, dass den Programmier:innen der unerwünschte Dominoeffekt den ihre Software auslösen würde nicht bekannt war. Dass in diesem Fall die Qualitätsprüfung der Software den Anforderungen nicht gewachsen war, kann systemischer Natur sein oder den Begebenheiten im weiteren Kontext in welchem diese Prüfung durchgeführt wurde, geschuldet sein. Der Dominoeffekt, der durch das Software-Update ausgelöst wurde, konnte mit grosser Wahrscheinlichkeit auch von der Wartungscrew vor Ort nicht erahnt werden. Es handelte sich wohl eher um ein unbekanntes Phänomen. Inwiefern die erwähnten 300 Nicht-Swisscom-Zahnräder im Notrufsystem einen Einfluss auf die Geschehnisse hatten, entzieht sich unserer Kenntnis. Sicher ist nur, dass sie eine systemisch beitragende Rolle spielten.
So kommt Komplexität daher.
Was dürfen wir daraus schliessen?
Wir haben es in diesem Fall mit einem System zu tun, welches sich nicht unter der Kontrolle einer einzelnen Organisation befindet. Die Systemgrenzen laufen weit ausserhalb des Unternehmens Swisscom. Sie reichen bis in die Politik und den föderalistischen Aufbau der Schweiz. Ein Auswechseln des CEOs würde eine Person an die Spitze des Unternehmens bringen, die nur potenziell mehr weiss oder kann, die aber mit demselben System konfrontiert wäre. Einem System welches sich nicht mit einem unternehmensinternen Knopfdruck ändern lässt. Ob eine solche Person überhaupt gefunden werden könnte, bleibt selbstredend dahingestellt.
Das Kennzeichen von komplexen Systemen ist nebst den tausendfach vorhandenen wechselseitigen Beziehungen auch der Umstand, dass sie sich nicht mehr steuern, sondern nur noch beeinflussen lassen. Und dass sie in der Lage sind, unerwünschte Ereignisse zu produzieren, obwohl alle korrekt nach Anweisung gearbeitet haben. Hier mit der mittelalterlichen Strafkeule anzusetzen, kommt dem Versuch gleich mit Jogging-Schuhen zum Eishockeymatch anzutreten. Die Sanktion ist im komplexen Umfeld zu einem stumpfen Werkzeug verkommen. Sie behindert, wie wir wissen, gar den geforderten Lernprozess.
Es macht viel mehr Sinn, dass wir uns gewahr werden, dass wir nicht zuletzt der Digitalisierung geschuldet, Systeme gebaut haben, die unserem Rechtsverständnis und unserer Vorstellung von Kontrolle und Verantwortlichkeit weit über den Kopf hinausgewachsen sind. Sie relativieren die Bedeutung des einzelnen Menschen - auch der Chefs. Wir können sie alle auswechseln auf jeder Stufe der Hierarchie und werden feststellen, dass dies nicht zur Lösung der Probleme führen wird. Die komplexen Systeme weisen uns mit unserem Wunsch nach Kontrolle in die Schranken und fordern uns auf, einem anderen Umgang mit ihnen zu finden.
Bei näherer Betrachtung verlangen sie nur etwas von uns: Dass wir sie verstehen lernen. Wir haben sie in vielen Iterationen und oftmals über lange Zeit entwickelt und es war nie jemand da, der sich um das Nachführen der Bedienungsanleitung gekümmert hätte. So bleibt uns nichts anderes übrig, als den mühsamen umgekehrten Weg zu gehen und durch Beobachtung zu lernen, wie sie wirklich funktionieren. Dazu benötigen wir Informationen und Daten, Hinweise und Meldungen von Mitarbeitenden und Vorgesetzten, die systemische Schwachpunkte aufdecken. Wir brauchen eine Kultur, in welcher das Melden von eigenen Fehlern wertgeschätzt wird. Wo Hinweisgeber keine Nachteile oder gar Sanktionen befürchten müssen. Wo die Strafe nur noch für ganz Grobes und Vorsätzliches im Werkzeugkasten der Führung liegt.
Loslassen
Wir dürfen dem Journalisten die Frage nach dem Rücktritt nicht übel nehmen. Sie kommt aus einer längst vergangenen Zeit der einfachen Systeme. Einer Zeit, die uns und unser Rechtsverständnis und unser Rechtssystem nachhaltig geprägt hat. So verwundert es nicht, dass der Reporter im ganzen Interview dem CEO der Swisscom nie die Frage gestellt hat, was getan werden müsste, um die Firma vor solch unerwünschten Ereignissen zu bewahren. Hoffen wir, dass es die nächste Generation von Journalisten schafft.
Die breite Anwendung von künstlicher Intelligenz steht vor der Tür. Die damit einhergehende massive Zunahme der Komplexität verlangt von uns im Umgang mit komplexen Systemen einen gesellschaftlich und kulturellen Entwicklungsschub. Dieser beginnt mit dem ersten Schritt: Werfen wir das Fehler-Schuld-Paradigma über Bord. Es hat seinen Dienst getan. Möge es in Frieden ruhen.