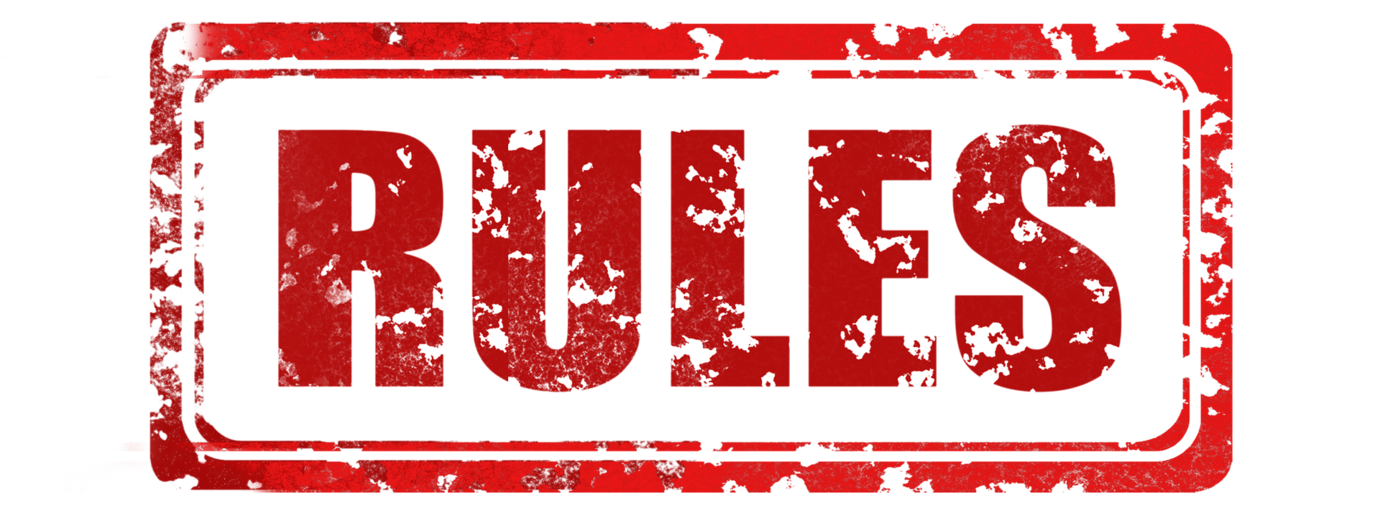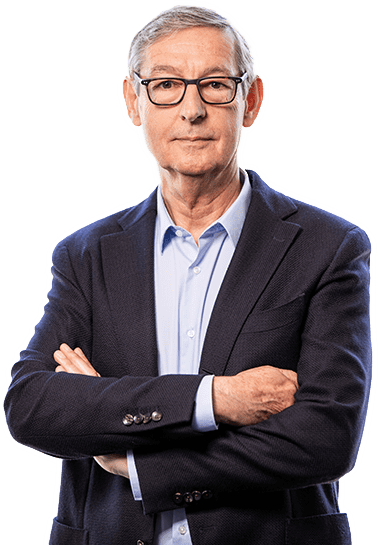Mit den Nachrichten über Schäden, die auf Grund von Verfehlungen entstanden sind, ist es wie mit den Jahreszeiten. Sie kommen und gehen mit einer rhythmischen Regelmässigkeit. Wenn uns eine Neue erreicht hat, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass ihr die nächste auf dem Fusse folgt. Offensichtlich ist es so, dass wir Menschen grosse Mühe haben, die Dinge über die Zeit richtig zu machen. Daher ist die nur empirisch belegte Weisheit von Murphy «Anything that can go wrong will go wrong» für viele von uns Gewissheit und nicht Hypothese. Und dies hat mit dem ärgerlichen Umstand zu tun, dass wir Menschen fehlbar sind.
Trotz dieses Wissens und trotz der selbst gemachten Erfahrung eines jeden darf es nicht sein! Der Aufschrei nach einem bekanntgewordenen Schaden ist jedes Mal unüberhörbar. Und stets ist in der emotionalen Aufgeregtheit deutlich zu erkennen, dass die Fehlbarkeit des Menschen in diesem aktuellen Fall nicht akzeptiert werden kann. Unsere Emotionen sorgen in der Empörung dafür, dass unser Denken gedrückt wird und dass wir Glaubenssätze, Fakten und wissenschaftlich verankertes Wissen, ja sogar Gewissheiten in den Wind schlagen. Daher wird von allen, die sich mit Fehlern von Menschen auseinandersetzten müssen, ein kognitiver Kraftakt abverlangt, so sie sich einer guten Problemlösung überhaupt annehmen wollen. Leider gibt es viele, die es nicht schaffen und die die Kraft dafür nicht aufbringen. Oft sind es Führungskräfte, die mit Fehlern konfrontiert werden. Und leider gibt es unter ihnen viele, die diesem Kraftakt nicht gewachsen sind. Sie nehmen den ‘easy way out’, lassen den Fehler am Menschen hängen und gehen zur Tagesordnung über.
Reflexhafter Ruf nach Kontrolle
Nicht nur das Abhandenkommen der Ratio ist typisch für die Auseinandersetzung mit dem Versagen und den oftmals damit einhergehenden Schäden. Ebenso symptomatisch ist der reflexhafte Ruf nach mehr Kontrolle nach mehr Aufsicht. Diese eindimensionale Reaktion versteift sich paradoxerweise im immer gleichen Konzept. Sie geht davon aus, dass ein mehr an Regulation künftige Schäden verhindern könne. Compliance (Regeltreue) ist ein sehr geschlossenes Konzept. Daher stösst es in unserer komplexen Welt an seine Grenzen. Und doch wissen wir, dass es eines jener Konzepte ist, welches uns geholfen hat, viel zu erreichen.
Wir haben grossartige Systeme geschaffen, deren Leistungen ungeahnt zuverlässig und sicher sind. Die Luftfahrt ist ein solches System. Es hat es in den letzten vielen Jahren geschafft, Milliarden von Menschen auf eine an sich riskante Art und Weise zu transportieren, ohne mehr nennenswert Schlagzeilen mit schweren Unfällen zu machen. Sie ist über die Jahre zur sichersten Transportart überhaupt avanciert. Ganz bestimmt hat die stringente Regulation dieser Industrie einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Darüber hinaus geht unsere Erfragung damit aber in zwei interessante und für die Zukunft wichtige Richtungen. Erstens sind wir an einem Punkt angelangt, an welchem wir feststellen müssen, dass mit mehr Regulation keine weiteren Benefits in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit mehr erreicht werden können. In nationalen und internationalen Regulierungsbehörden wir diese Erfahrung intensiv diskutiert. Zweitens gehen wir davon aus, dass ein mit Regulation beschriebenes und ‘gezeichnetes’ System (dank Compliance) so funktioniert, wie es gedanklich determiniert und aufgesetzt wurde. Doch wie wir nun lernen müssen, ist das über weite Strecken ein Trugschluss.
Wir machen uns als Erfinder oder Gestalter unserer soziotechnischen Systeme arg viel vor, wenn wir glauben, diese bis ins letzte Detail beschreiben zu können. Dazu müssten wir Kompetenzen haben, die wir gemeinhin Gott attestieren. Vielmehr ist es so, dass die Menschen in diesen Systemen tagtäglich damit beschäftigt sind, alle nicht festgelegten Dinge sinnvoll zu ergänzen und zu überbrücken. Sie sorgen mit ihren Handlungen dafür, dass systemisch angelegte Ungereimtheiten, Lücken, Risiken oder Zielkonflikte erfolgreich gemeistert und überwunden werden. Die künftigen Konzepte, die uns helfen werden, die Dinge zuverlässiger, sicherer und die Systeme resilienter zu machen, werden sich intensiv mit diesen besonderen menschlichen Stärken befassen. Der Ruf nach mehr Regulation, sobald irgendwo Versagen festgestellt wurde, verhallt in Anbetracht dieses Wissens in den Mottenkisten der Industriegeschichte.
Wir brauchen andere Ansätze.
Wenn wir uns der rhythmischen Regelmässigkeit entziehen wollen, mit der wir mit Nachrichten über Versagen und Schadenfällen bedacht werden, dann sollten wir den Blick über die Compliance hinaus auf die Rahmenbedingungen richten, die unsere Unternehmen und Organisationen brauchen, um Schaden von ihnen und von uns abzuwenden. Sie alle sind darauf angewiesen, dass sie innerhalb ihrer Systeme lernen können. Dazu sind sie auf die Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden angewiesen, die diese in ihrem Zusammenwirken mit dem System machen. Denn es gibt viele schadenauslösende Begebenheiten im Unternehmen, die ihren Ursprung in falschen Anreizen des Systems haben und die in fehlerhaftem Handeln der Menschen zum Ausdruck kommen oder deren Grund sind. Und es gibt systemische Fehlkonzeptionen, die für potenzielle oder gar wiederkehrende Schäden direkt verantwortlich sind. In beiden Fällen ist es für die involvierten Mitarbeitenden nicht einfach, sich zu melden und auf den selbst gemachten Fehler oder die systemische Unzulänglichkeit hinzuweisen. Denn sie laufen unter Umständen das Risiko, dass ihre Vorgesetzten der Auffassung sind, dass das System perfekt sei oder dass sie einen gemachten Fehler eines Mitarbeiters intellektuell nicht in Verbindung mit systemischen Unzulänglichkeiten bringen wollen oder können. Beide Reaktionen von Vorgesetzten sind weitherum bekannt und stellen eine innerbetriebliche Herausforderung erster Güte dar.
Doch auch wenn ein Unternehmen diese Hürde genommen hat, indem den Führungskräften diese Zusammenhänge erklärt wurden und sie sie in ihrer Arbeit berücksichtigen, braucht es Rahmenbedingungen, um eine reife Fehlerkultur, eine Just Culture, leben zu können. Das Unternehmen muss in der Lage sein, eine Datenbank zu führen, in welcher es sämtliche Fehler und Fastvorkommnisse listet. Es muss in der Organisation offen darüber gesprochen werden dürfen, damit die Erfahrungen sinnvoll weitergegeben werden können. Doch diese Daten, wie sie in Critical Incident Reporting Systemen von Spitälern oder in Sicherheitsmanagement Systemen der Industrie erfasst werden, müssen durch noch zu schaffende Gesetze vor einem inadäquaten Zugriff durch Dritte geschützt sein. Ebenso sind die Meldepersonen zu schützen, die auf Unzulänglichkeiten oder auf eigene Fehler hingewiesen haben. Sind diese Rahmenbedingungen gegeben und hat eine Just Culture Fuss gefasst, so werden die Korrekturen am System feinmaschig, schnell und effektiv. Eine Just Culture durchdringt das System Hand in Hand mit den Mitarbeitenden. Sie erstickt Strohfeuer im Keim und glättet die Wogen, bevor sie Schaden angerichtet haben. Sie ergänzt das grobschlächtige Konzept der Compliance, welches uns allzu oft enttäuscht hat und nie in der Lage war, das abzuliefern, was wir als Hoffnung hineingesteckt haben.
Was uns noch fehlt, um sicherer zu werden.
Nach der Häufung von Pannen und Skandalen, die sich in Bundesbetrieben wie SBB, Post und Swisscom in letzter Zeit ereignet haben, fordern Ständeräte nun Remedur. In einer Motion verlangen sie ein Gesetz, um die Aufsicht über diese sich mehrheitlich in Bundesbesitz befindenden Unternehmen zu stärken. Nach Auffassung der Ständeräte der zuständigen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen muss der Einfluss des Parlaments auf die säumigen Betriebe deutlich erhöht werden. Die Absicht dieses Begehrens ist unschwer zu erahnen. Die gravierenden Fehlleistungen sollen mit erhöhter Kontrolle reduziert werden.
Wie wir sehen, ist der Reflex nach mehr Kontrolle auch in Bundesbern am Wirken. Das ist schade, denn in der Schweiz hat die Politik eine alte Tradition. Sie versteht sich als Rahmensetzerin für die Akteure der Gesellschaft und der Wirtschaft. Dieser Rahmen soll es den Unternehmen erlauben, in einem fairen Wettbewerb und selbstverantwortlich die besten Lösungen zu suchen und anzubieten. Und wenn es um das Vermeiden von Fehlleistungen geht, so brauchen sie nicht mehr Vorgaben und Kontrolle, sondern Gesetze, die ihnen das Aufbauen und Verankern von Fehlerkulturen erlauben. Sie müssen die Sicherheit vom Gesetzgeber haben, dass sie kritische Daten erheben und aufbewahren können und dass diese sowie ihre Meldepersonen geschützt sind.
Der historisch bedingte Reflex zu mehr Kontrolle ist zwar verständlich, aber in der heutigen Welt ist er überholt und unzweckmässig. Wenn sich das Parlament der Schweiz tatsächlich dafür interessiert, wie es einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leisten könnte, so kann es sich mit einem neuen Verständnis des Themas ans Werk machen. Die Schweizer Wirtschaft und unser Gesundheitswesen brauchen dringend Gesetze, welche Meldepersonen und sicherheitsrelevante Daten schützen. Sie benötigen Lernzonen, die frei von Angst sind. Zonen, in denen es Individuen ermöglicht wird, ihre Lehren aus Fehlern zu ziehen und Zonen, in denen unermüdlich an der Verbesserung unserer komplexen soziotechnischen Systeme gearbeitet werden kann.