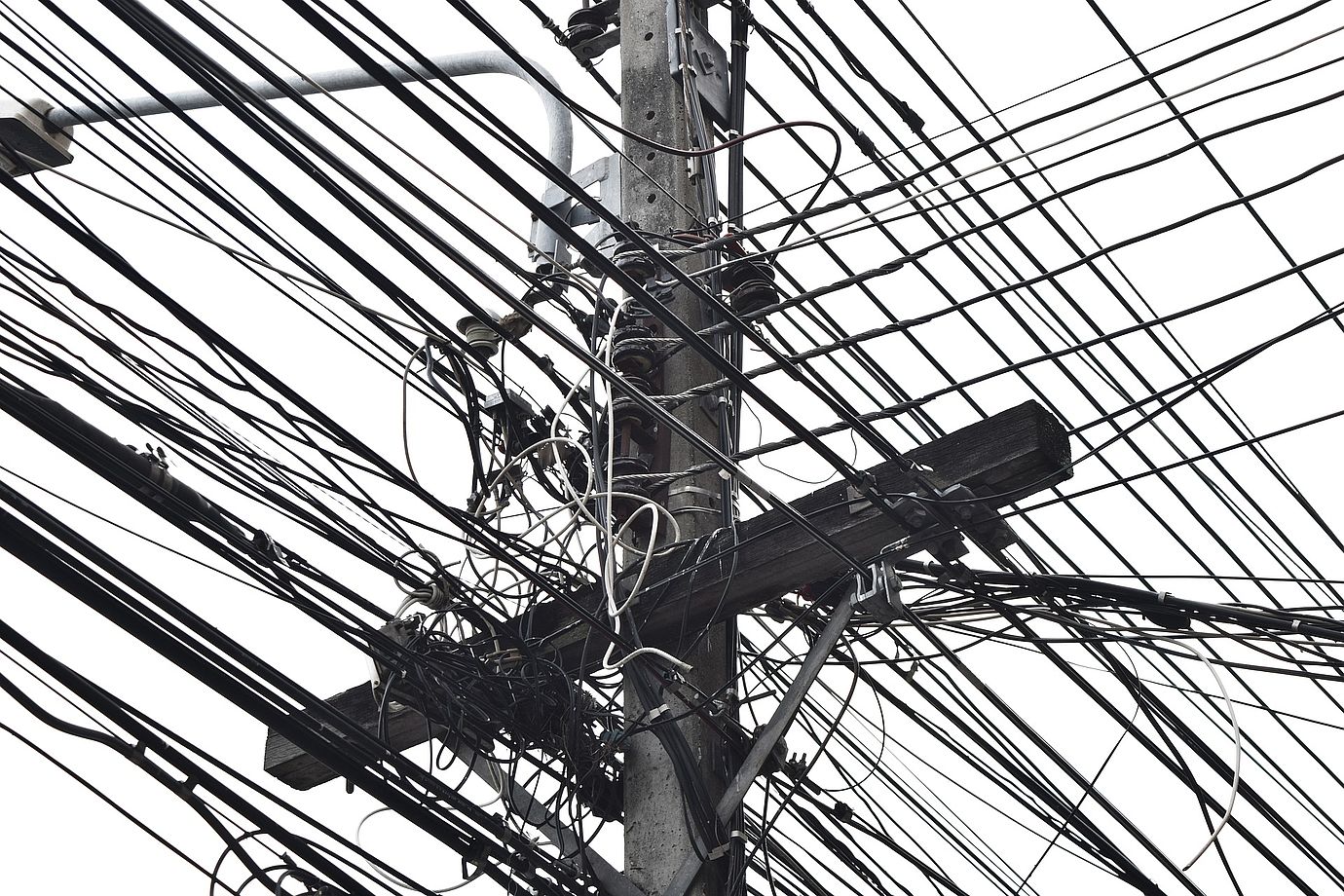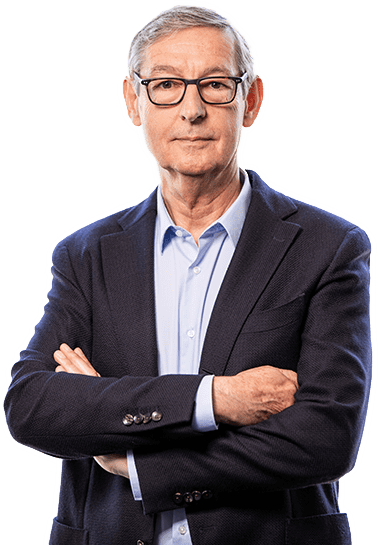Das ‘Lernen-aus-dem-Fehler’ hat heute nahezu den Status eines Hypes erreicht. Es ist in Allerleute Mund, wird von Beratern empfohlen und erscheint bei vielen Managern in ihren Führungsphilosophien. Es ist gegenwärtig als Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung, zur Weiterentwicklung und vor allem zur Steigerung der Agilität breit akzeptiert. Da und dort werden damit tatsächlich auch Fortschritte gemacht. Das wird in jenen Unternehmungen der Fall sein, denen es gelungen ist, eine Fehlerkultur aufzubauen und in ihrer DNA zu verankern. Doch viele schaffen das nicht. Dies, obwohl die Fehlerkultur im Leitbild erscheint, in der realen Welt des Betriebs aber nicht gelebt wird. Das hat seine Gründe.
Der angstfreie Umgang mit dem Arbeitsfehler
Beginnen wir bei der Feststellung, dass sich eine Fehlerkultur durch einen angstfreien Umgang mit dem Arbeitsfehler auszeichnet. Das schafft eine Organisation, wenn sie das Prinzip durchgesetzt hat, dass solche Fehler, sie werden neudeutsch auch ‘Honest Mistakes’ genannt, nie punitiv behandelt werden. Bei dieser Art von Versehen sind weder Absicht, Vorsatz, noch grobe Fahrlässigkeit im Spiel. Das wiederum heisst nichts anderes, als dass Fahrlässigkeit grundsätzlich hingenommen wird, in dem Sinne, als dass den Betroffenen nie Nachteile aus solchen Fehlern erwachsen dürfen. Für die eine oder den anderen unter Ihnen ist das eine deftige Ansage. Was kommt Ihnen als Führungskraft spontan in den Sinn, wenn Sie das hören?
Mir ist bewusst, dass es für einige unter Ihnen keine Neuigkeit ist und Sie sich fragen, ob es sich noch lohnt, weiter zu lesen. Nein. Es lohnt sich nicht. Denn wenn Ihre Reaktion so ausfällt, haben Sie in Ihrer Organisation einen langen und wertvollen Weg hinter sich. Dann wissen Sie, wie in heutigen komplexen betrieblichen Umfeldern die Sicherheit immer noch verbessert werden kann. Sollten Sie hingegen, sei es auch nur kurz gestutzt haben, lohnt es sich für Sie möglicherweise mit der Lektüre fortzufahren. Vielleicht haben Sie sich beim Lesen, dass Fahrlässigkeit okay ist, ertappt, dass Ihr erster Gedanke mit den Worten ‘Ja aber…’ begonnen hat. Immer wenn uns das über die Lippen kommt oder durch den Kopf geht, ist noch eine andere Meinung mit im Spiel. Diese könnte auf einem Rechtsverständnis ruhen, dem es nicht gelingt, Fahrlässigkeit mit einer Absolution reinzuwaschen. Grundsätzlich schon gar nicht. Das ist mehr als verständlich, denn in der Justiz wird Fahrlässigkeit sehr oft geahndet. Das heisst, dass Sie mit dem Trigger ‘Fahrlässigkeit’ unbewusst eine Bewertung vornehmen und intuitiv urteilen und richten. Und schon sind Sie auf der falschen Spur. Das Paradigma ‘Wo Fehler – da Schuld’ hat Sie eingeholt. Und dies, obwohl Sie sich eigentlich vorgenommen hatten, 2021 dem Fehler mit einer anderen inneren Einstellung zu begegnen. Bleiben Sie standhaft! Versuchen Sie ab sofort fahrlässig begangenen Arbeitsfehlern ohne Urteil zu begegnen. Immer!
Every thing goes?
Nie urteilen? Dieser Gedanke könnte anstrengend sein. Denn wenn ab sofort in Ihrem Betrieb fahrlässige Handlungen konsequenzenlos sind, warum sollten sich die Mitarbeitenden noch Mühe geben? Das wäre, wie wenn alles in Ihrem Unternehmen einfach durchgeht – every thing goes? Das sind beängstigende Aussichten, die Sie nicht verantworten möchten. Unsicherheit oder gar Angst schleichen sich ein. Vielleicht auch Anzeichen von Opposition zur Fehlerkultur. Wird da ein zahnloses Management gepredigt? Haben ab sofort alle lieb zueinander zu sein und darf ich als Chef nichts mehr sagen? Ist das die totale Weichspülung?
Ich erlebe diese Unsicherheit oder kritische Abwehrhaltung bei Führungskräften als Change Agent in der Organisationsentwicklung an dieser Stelle immer wieder. Sie ist verständlich, denn sie wird nicht nur gespiesen durch die Furcht, dass nun das grosse Laissez-Faire einkehrt, gar Kontrollverlust droht. Sondern ebenso durch die Frage, welche Rolle die Führungskraft in einem solchen Szenario einzunehmen hat und wie Führung gestaltet sein muss, damit es gelingt, eine Fehlerkultur aufzubauen und zu verankern. Wozu sind Sie als Führungskraft denn noch da, wenn die Leute überspitzt gesagt tun und lassen können, was sie wollen und nichts mehr Konsequenzen hat?
Der Fehler, eine Chance für alle
Nun, es wäre eine verpasste Chance, wenn ein Fehler keine Folgen hätte. Doch sollten wir uns davon verabschieden, dass Konsequenzen nur in Form von Anschuldigungen, Rügen oder gar Bestrafungen bestehen können. Wir wissen, dass es die Falschen sind. Sie führen in die Angstkultur und hemmen nicht nur den Fortschritt und die Performance, sondern sind korrosiv für das Betriebsklima. Zielführende Konsequenzen gibt es viele. Wir werden schnell fündig, wenn wir uns die Verantwortlichkeiten der involvierten Akteure veranschaulichen und uns fragen, wie sie diesen am besten gerecht werden können. Bei jedem Ereignis stehen sowohl die beteiligten Mitarbeitenden in der Pflicht als auch ihre Vorgesetzten. Für Erstere gelten vorab die Bereitschaft und der Wille, Vorfälle zu melden. Sie tun dies nachvollziehbarerweise nur, wenn sie sich nicht vor negativen Konsequenzen fürchten müssen. Anschliessend zeichnet sich verantwortliches Handeln bei der Analyse des Vorkommnisses durch das offene Gespräch und durch eine reflektierte Selbstanalyse aus, die sich um die persönlichen ‘Lessons Learned’ dreht. Das alles sind unzweideutige und sichtbare Anzeichen der Betroffenen, ihren Teil der Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen. Fehlen sie, verletzt der Mitarbeitende seine Pflicht an der kontinuierlichen Verbesserung mitzuwirken und muss richtigerweise mit Sanktionen für derartige Unterlassungen rechnen.
Shared, forward-looking Responsibility
Die Pflicht der Führungskräfte besteht darin, sich für die Analyse des Vorgefallenen Zeit zu nehmen oder jemanden mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Denn Fehler sind Lernchancen und stellen ein hohes Gut dar. Es ist die Verantwortung der Vorgesetzten, sich den systemischen Komponenten, die bei Vorfällen mitverursachend eine Rolle spielen, anzunehmen und dafür zu sorgen, dass wo immer möglich, Remedur geschaffen wird. Leider werden Führungskräfte, die dieser Verantwortung nicht gerecht werden, nur selten, eher gar nicht für ihre Unterlassungen sanktioniert. Der Umstand, dass dem häufig so ist, ist eine weitverbreitete Dysfunktionalität in vielen Unternehmen. In einer reifen, etablieren Fehlerkultur übernehmen beide ‘Parteien’ ihre Verantwortung für das, was künftig besser sein wird. Die Änderung des Verhaltens aufgrund eines persönlichen Lernprozesses und die Veränderung des Systems, welches sicherer und oder effizienter dastehen wird. Es handelt sich um eine geteilte ‘vorwärtsschauende Verantwortung’.
Wenn wir diese 'shared responsibility' verstanden haben, klärt sich damit auch die Rolle der Vorgesetzten bei der Aufarbeitung von ungewollt eingetretenen Ereignissen. Eine wichtige Komponente kommt für die Führungskräfte jedoch noch dazu. Mitarbeitende, die ursächlich an Vorfällen beteiligt sind, insbesondere an solchen mit hoher Schadensfolge, machen sich in den meisten Fällen grosse Vorwürfe. Sie schämen sich und wünschen sich, einen Beitrag zur Wiedergutmachung leisten zu können. Suchen Sie als Vorgesetzte nach solchen Möglichkeiten. Unterstützen Sie die Beteiligten und helfen sie mit, sie vom ‘Fehler-Schuld Paradigma’ zu befreien und wertschätzen sie die gezeigte Offenheit und die Bereitschaft, die Lehren aus dem Vorfall für sich persönlich ziehen zu wollen.
Wenn ein Fehler passiert, fühlen sich normalerweise die Betroffenen verantwortlich. Wenn im Unternehmen für alle geklärt wird, wie sie ihre Verantwortung in obigem Sinne wahrnehmen können, ist schon sehr viel erreicht. Noch mehr liegt drin, wenn auch die Führungskräfte im Falle von Fehlern ihrer Mannschaft ein Bewusstsein für ihre Mitverantwortung entwickeln.
Warum kommt Unsicherheit auf?
Diese Rollenklärung zeigt auf, wie Führung gestaltet sein sollte, wenn Fehler passieren. Sie nutzt die Chance des Vorkommnisses nicht nur für die Verbesserung des Systems, sondern auch für die Vertiefung des gegenseitigen Vertrauens. Diese Klärung kann Führungskräften Mut zum nicht punitiven Umgang mit dem Arbeitsfehler machen. Sie nimmt aber jenen Managern die Unsicherheit nicht, die sich davor fürchten, dass ein Ausbleiben der Rüge oder Strafe im Fehlerfall einen negativen Einfluss auf die Arbeitsleistung der Mannschaft hätte. Was wären denn die Gründe und Motive der Mitarbeitenden, sich nicht mehr in gleichem Masse einzusetzen? Lebt die Annahme immer noch, dass eine angedrohte negative Konsequenz motivierend wirkt? Im schulischen Umfeld wird in diesem Kontext von schwarzer Pädagogik gesprochen. Wer sich dabei ertappt, mit solch überholten Führungsansätzen zu kokettieren, ist nach wie vor im Fehler-Schuld-Paradigma gefangen und bekundet grosse Mühe, die Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht hilft zur Orientierung die interessantere Frage: Welche negativen Konsequenzen hat ein Unternehmen zu gewärtigen, wenn es eine Angstkultur hochhält? Was alles liegen bleibt und verpufft, wenn sich alle nur noch an die Regeln halten. Wenn sämtliche Entscheide nach oben abgeschoben werden. Wenn keine Bereitschaft mehr gezeigt wird, Verantwortung zu übernehmen. Wenn sich zum Selbstschutz eine Strategie des sich Schadloshaltens etabliert hat.
Es steht viel auf dem Spiel und es ist an den Führungskräften zu entscheiden, wie sie Erfolge herbeiführen wollen. Dabei ist es irrelevant, ob unter Erfolg ‘Sicherheit’ verstanden wird oder ökonomische Errungenschaften. Eine gut verankerte Fehlerkultur dient beiden in gleichem Masse.