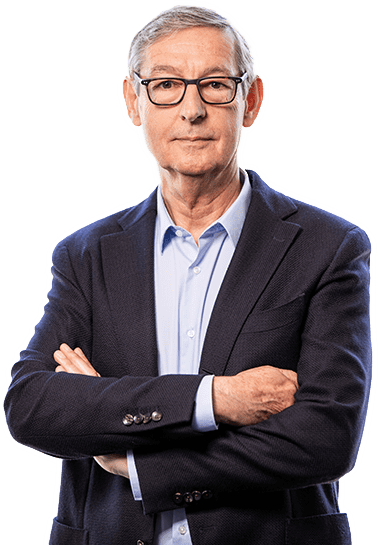Mit seinem Urteil vom 29.6.2020 spricht das Bundesgericht einen von der Staatsanwaltschaft angeklagten Fluglotsen frei. Dieser habe am 20. August 2012 am Flughafen Kloten für eine angeblich gefährliche Annäherung zweier Flugzeuge gesorgt. Das Bundesgericht stützt dabei das Urteil der kantonalen Vorinstanz und legt in seiner Begründung dar, dass eine hinreichend konkrete Gefährdung nie existiert habe. Sie wäre eine Voraussetzung, um gemäss geltendem Recht eine Strafe anordnen zu können. Dass die Staatsanwaltschaft das Urteil der Vorinstanz nicht akzeptierte und den Fall vor das Bundesgericht zog, lässt aufhorchen. Gab es wirklich eine Notwendigkeit für diesen staatlichen Eifer?
Beim Straftatbestand ging es um die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Am Umstand, dass sich der Staat um die Gewährung eben dieser aktiv bemüht, ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Bei der Frage, wie er das tut, kommen aber Zweifel auf, über die wir uns in der Gesellschaft Gedanken machen sollten. Es ist kein Zufall, dass die Aviatik in dieser Sache ihre Stimme kritisch erhebt. Denn wenn es darum geht, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, ist sie in besonderem Masse gefordert. So ist es naheliegend, dass sich in diesem Hochrisikobereich Wissen angesammelt hat und Konzepte entwickelt wurden, die aufzeigen, wie Sicherheit in hochkomplexen soziotechnischen Systemen sichergestellt und weiter verbessert werden kann.
Beim Lesen des bundesrichterlichen Urteils wird klar, dass gemäss geltendem Recht eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur in Bezug mit den Handlungen eines fehlbaren Menschen gesehen wird. Der Staat tu so, als ob die öffentliche Sicherheit allein durch menschliches Fehlverhalten gefährdet werden könnte. Damit negiert er all die in der Organisation und im Gesamtsystem schlummernden Hotspots, die einen nachweislich negativen Einfluss auf die Sicherheit haben. Einmal mehr vermissen wir also die Beurteilung der systemrelevanten Aspekte. Es ist, als wären sie inexistent. Welch ungeheure Verkürzung. In einem derart trivialisierten Weltbild lässt es sich gut leben. Aber gerechte Urteile, solche, die etwas mit der Welt, wie sie die Menschen erleben, zu tun haben, kann eine derartige Praxis nur zufallsweise oder über Umwege fällen. So wie in diesem Fall, wo eine von der Staatsanwaltschaft ins Spiel gebrachte Gefährdung vom Bundesgericht nicht gesehen wurde.
Die systemische Perspektive verstehen
Handlungen von Menschen, die in komplexen Systemen tätig sind, sind mannigfaltigen Einflüsse des Kontextes ausgesetzt. Wir müssen, um dies zu verstehen, nicht einmal die Forschungsarbeiten von grossen Verhaltensökonomen wie dem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann bemühen. Es reicht völlig aus, wenn wir uns die offenkundigsten Zusammenhänge ansehen.
Beim obersten und wichtigsten Aspekt geht es um die Eröffnung von Strafverfahren mit ihrem negativen Einfluss auf das Meldeverhalten der Mitarbeitenden an der Front. Unter geltendem Strafrecht, welches nicht nur vorsätzliche, sondern auch leicht fahrlässige Handlungen bestraft, sind Meldungen über sicherheitsrelevante Ereignisse daher stets mit Angst der Meldenden verbunden. Die daraus resultierende Zurückhaltung beim Rapportieren unterminiert die Sicherheitskultur im Unternehmen und in der ganzen Community. Das ist gravierend, denn das schmälert die Datenbasis des Sicherheitsmanagements und verhindert das Aufstellen von wirkungsvollen Sicherheitsbarrieren. Zum Leidwesen der Öffentlichkeit, die sich in den Flugzeugen gerne sicher fühlt.
Aus den öffentlich zugänglichen Dokumenten des erwähnten Falles ist nicht ersichtlich, ob der Lotse mit seinem Handeln geltende Regeln missachtet oder dagegen verstossen hat. Wir müssen oder dürfen davon ausgehen, dass er regelkonform gehandelt hat. Denn sonst wäre dieser Umstand bestimmt prominent abgehandelt worden. Trägt er nun allein die Verantwortung für das Geschehene? Der Fall ist ein Musterbeispiel für Vorkommnisse in hoch komplexen Systemen, in welchen es zu unerwünschten Ereignissen kommen kann, obwohl sich alle an die Regeln halten.
Auch ist nicht ersichtlich, ob sein Handeln nicht der ‚Best Practice‘ in der Luftverkehrskontrolle entsprach. Es wird nicht darauf eingegangen, ob ein anderer Lotse in der gleichen Situation gleich gehandelt hätte. Insbesondere der zweite Aspekt ist von besonderer Bedeutung, will man der beschuldigten Person nur annähernd gerecht werden. Das zeigt, dass die übliche Praxis in der Rechtspflege nicht zertifiziere Gutachter wie in anderen Ländern beizuziehen, nicht zielführend ist. Es braucht Sachkenntnis vom spezifischen Arbeitsumfeld des Betroffenen, welches auch die Kultur des Unternehmens miteinschliesst. Denn da würde man fündig bei der Frage, ob er gegebenenfalls einem kulturell verankerten Wertgefüge Folge leistete, das der Effizienz der Auftragserledigung einen inadäquaten Stellenwert beimisst. Die Entscheidungsträger an der Front sind nämlich täglich Dutzende Male mit einem Zielkonflikt konfrontiert, der sie auffordert, sich zwischen Ernsthaftigkeit (Sicherheit) und Effizienz zu entscheiden. Da sie das Unternehmen bei dieser Entscheidung allein lässt, orientieren sie sich verständlicherweise an der gängigen Praxis. Sie entscheiden so, wie man das eben in dieser Firma macht. Sie handeln nach Regeln, die in grossen Lettern an der Wand stehen, aber in keinem Buch zu finden sind. Ist es redlich, wenn ihnen im Ereignisfall vorgeworfen wird, sie hätten der Ernsthaftigkeit der Auftragserledigung und damit der Sicherheit zu wenig Beachtung geschenkt? Dies, obwohl alle wissen, dass, wenn sie sich stets für die Ernsthaftigkeit entscheiden würden, der ganze Laden zum Stillstand käme?
Wenn im Nachgang zu einem unerwünschten Ereignis ein Urteil über einen Entscheidungsträger an der Front gefällt wird, ohne dass dabei zwingend diese Fragen geklärt wurden, ist das nicht redlich. Es ist undifferenziert und billig, weil es alle anderen Stakeholder, die am Design des Systems mitgewirkt haben, nicht in die Verantwortung zieht. All das zeigt, mit welcher Einäugigkeit der Rechtsstaat handelt und wie unbedarft er mit der modernen, komplexen Welt umgeht, in welcher sich die Akteure in der Luftfahrt Tag täglich bewegen.
Die Legislative ist gefordert
Es geht hier nicht um eine Kritik an den handelnden Akteuren im juristischen Bereich. Sie sind gehalten, das Recht umzusetzen. Es ist eine Kritik an der Legislative, welche solche Zustände nach wie vor duldet, stillschweigend toleriert und uns Bürger staunend, kopfschüttelnd, ja ratlos zurücklässt. Wir haben ein berechtigtes Bedürfnis, dass versucht wird, die öffentliche Sicherheit mit dem heute verfügbaren Wissen zu gewährleisten. Die in grauer Vorzeit entwickelten Ansätze, die entstanden sind, als der Mensch noch nicht in komplexen soziotechnischen Systemen tätig war, wo sein Handeln stets direkt kausal mit dem Resultat seines Wirkens verbunden war, greifen heute klar zu kurz.
Es geht nicht darum, den Menschen aus seiner Verantwortung zu befreien. Es geht darum, sein Handeln mit einem ganzheitlichen Blick und unter Berücksichtigung der vielfältigen systemischen Einflüsse zu würdigen. Alles andere ist unredlich.
Wir können es uns nicht mehr leisten, nicht in den Spiegel zu schauen. Wir müssen uns irgendwann der Tatsache stellen, dass wir Systeme gebaut haben, die wir nicht mehr ganz beherrschen können und in denen wir Menschen arbeiten lassen, die den systemischen Einflüssen voll ausgesetzt sind. Sie im Ereignisfall ungeachtet dieser Umstände wie Kanonenfutter zu behandeln ist nicht okay. Manchmal ‚überleben‘ sie und werden wie in diesem Fall freigesprochen, manchmal werden sie bestraft. Gewiss ist bei diesen archaisch anmutenden Verfahren lediglich, dass alle anderen Stakeholder, die am Aufbau der komplexen Systeme tatkräftig mitgewirkt haben und daher Mitverantwortung tragen, stets ungeschoren davonkommen. Diese simple Reduktion der Betrachtung auf das handelnde Individuum ist einer zivilisierten Gesellschaft nicht würdig.
Was wir brauchen
Wir haben in der Luftfahrt gelernt, dass wir die Sicherheit mit einem systemischen Ansatz angehen müssen, in welchem der Mensch dank seiner enormen Anpassungsfähigkeit die Gatekeeper Rolle übernimmt. Wir haben gelernt, dass Fehler wichtige Symptome eines nicht optimal funktionierenden Systems sind. Daher verstehen wir den Fehler als Lernchance und tun alles, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Just Culture, zu gut Deutsch ‚Redlichkeitskultur‘, hilft uns dabei. In jedem Einzelfall wägen wir mit einem Balance Check ab, ob er sich fürs Lernen eignet oder ob ein grobfahrlässiges oder gar ein willentlicher Verstoss gegen geltende Regeln vorliegt. Denn beides wird selbstredend nicht akzeptiert und geahndet. Wie wir als Gesellschaft mit dieser Problematik umgehen können, hat der Dachverband der Schweizer Luft- und Raumfahrt / AEROSUISSE in ihrem Whitepaper am Beispiel und im Kontext der Luftfahrt dargelegt.
AEROSUISSE: Verankerung der Just Culture Prinzipien im Schweizer Recht