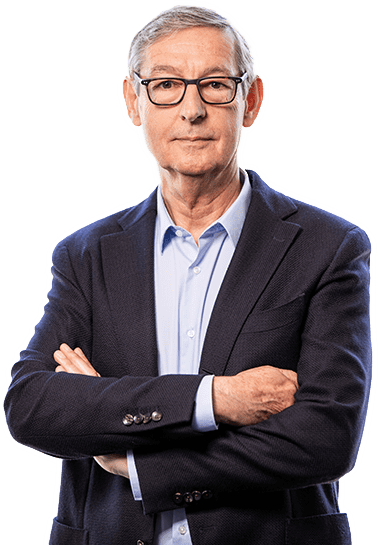Wir sind im letzten Blog einer perfiden Irrationalität nachgegangen, die es uns als Führungskräfte schwer macht, für psychologische Sicherheit in der Organisation zu sorgen. Leider ist es nicht die Einzige, der wir uns näher widmen sollten. Ein weiteres Handicap, welches uns die Natur auferlegt hat, macht uns zu schaffen, in unserem Bemühen, im Unternehmen eine Sicherheitskultur zu verankern, die den Namen verdient. Eine, die sich nicht dadurch kennzeichnet, dass die Vorgesetzten ihre Erwartungen an das Verhalten der Mitarbeitenden perfektionieren und in immer eindringlicheren Appellen und ausführlicheren Leitbildern, Weisungen und Reglementen darlegen. Sondern eine, die auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens steht und in der es den Führungskräften gelingt, psychologischen Sicherheit als Kulturelement zu gewähren. Es ist das Phänomen des Rückschau- und Ergebnisfehlers, welches wir näher betrachten müssen. Auch dieser Denkfehler ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Sie steht im Zusammenhang mit der Problematik der Schuldzuweisung und hat damit einen direkten Einfluss auf das Vertrauensverhältnis. Vertrauen aber ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgversprechende Sicherheitskultur.
Die Wirkung des Rückschau- und Ergebnisfehlers
Zuerst führt dieser Denkfehler dazu, dass wir glauben, dass wenn das Ergebnis einer Aktion schlecht war, auch die Handlungen der involvierten Akteure schlecht waren. Wir nehmen in solchen Fällen an, dass es falsche Entscheidungen, mangelhafte Situationsanalysen oder verpasste Chancen waren, die die Gründe für das schlechte Resultat waren. Der Rückschaufehler ist daher schnell anschuldigend und untergräbt das Vertrauen. Die Annahme, dass die Akteure, sprich die Menschen, fehlbar waren, ist oft das Produkt des Denkfehlers, dem wir im letzten Blog nachgegangen sind. «What you see is all there is» (WYSIATI-Regel). Jene Wahrnehmungsverzerrung, die uns auch aufgrund minimaler Informationen ungefragt eine kohärente Geschichte präsentiert.
Wir können weiter beobachten, dass Handlungen im Lichte der Schadenslage im Nachhinein als Fehler taxiert werden, obwohl sie in der Situation selbst für die Akteure als normal, vernünftig und angebracht beurteilt wurden. Oftmals wird eine Handlung deshalb als unverantwortlich risikoreich bewertet. Nehmen wir als Beispiel einen risikoarmen chirurgischen Standardeingriff, bei dem es zu Komplikationen kommt und der Patient stirbt. Die Hinterbliebenen, Anwälte oder Richter werden in der Rückschau zu der Ansicht neigen, dass der Eingriff von Anfang an riskant war. Sie sind davon überzeugt, dass der Arzt es hätte besser wissen müssen.
Des Weiteren führt dieser Denkfehler dazu, dass die Eintretenswahrscheinlichkeit des Vorfalles generell überbewertet und die Fähigkeit der Involvierten, diese richtig einzuschätzen, als ungenügend beurteilt wird. Was nichts anderes heisst, als dass wir uns im Moment, in welchem wir von der Schadenslage Kenntnis erlangen, glauben machen, ein faktisch richtiges Urteil über die Eintretenswahrscheinlichkeit abgeben zu können. Das ist eine Überheblichkeit, die jene herabsetzt, die in die Ereignisse verwickelt waren. Könnten wir diesen Denkfehler nicht einer von der Natur aus uns mitgegebenen Irrationalität zuschreiben, müssten wir uns korrekterweise dafür entschuldigen.
Diese drei Effekte des Rückschaufehlers untergraben das Vertrauen in besonderem Masse, weil die Ursache für den Schaden bei allen implizit immer beim Menschen liegt und ihm so die Schuld zugeschoben wird. Jede unreflektierte Reaktion einer Führungskraft auf ein unerwünscht eingetretenes Ereignis unterminiert daher den Aufbau einer Vertrauenskultur. Ich werde in einem nächsten Blog dieser Problematik nachgehen.
Von systemischer Bedeutung hingegen ist der Umstand, dass mit dieser Wahrnehmungsverzerrung die Gründe, die zum Vorfall führten, unkritisch betrachtet werden und die Ursachenfindung viel zu oberflächlich abgewickelt wird. Denn sie macht uns glauben, dass wir es ja schon immer gewusst haben. Somit kennen wir auch die Ursachen bereits und jede weitere Beschäftigung mit dem Fall erübrigt sich. Diese Beobachtung zeigt, dass es unter einer solchen Deutung eines Vorfalles für die Sicherheitsexperten sehr schwierig wird, im Unternehmen die notwendigen Ressourcen zu bekommen, die eine professionelle Untersuchung nun einmal benötigt. Erst diese wird das Unternehmen in die Lage versetzten, tatsächlich zu lernen.
Was gilt es zu tun?
Einige dieser Konsequenzen des Rückschau- und Ergebnisfehlers sind für die in Vorfälle involvierten Personen schwer zu ertragen. Sie führen in Kombination mit der WYSIATI-Regel zum einen bei urteilenden Vorgesetzten dazu, dass sie den Betroffenen und der von ihnen erlebten Situation nicht gerecht werden. Das untergräbt auf korrosive Weise die Beziehung und das gegenseitige Vertrauen. Zum anderen hindern sie die Führungskräfte daran, Verantwortung für die Organisation zu übernehmen und sich für die Verbesserung des Systems einzusetzen, weil sie glauben, die Ursachen zu kennen. Es ist schon viel gewonnen, wenn diese Effekte den Führungskräften bewusst sind. Das hilft ihnen, ihre negativen Auswirkungen zu überwinden und bspw. die Situation so zu sehen und zu verstehen, wie sie sich den Betroffenen präsentiert hat, bevor die Ereignisse ihren Lauf genommen haben.
Im Rahmen von Projekten der Sicherheitskulturentwicklung ist es aus meiner Erfahrung daher wichtig, den Führungskräften die Gelegenheit zu geben, sich mit dieser robusten und perfiden kognitiven Illusion näher zu befassen. Denn wir verzichten ungern auf eine Vorstellung, die uns glauben macht, wir könnten die Unvorhersehbarkeit der Welt erfassen. Wenn wir uns vom tröstenden "Ich-hab’s-immer-schon-gewusst" lösen müssen, kommen wir als Führungskräfte mit Kontrollverlust in Kontakt. Das ist unangenehm. Es lohnt sich, bei solchen Auseinandersetzungen einen Coach zur Seite zu haben.
Oberstes und wichtigstes Gebot im Zusammenhang mit dem Rückschau- und Ergebnisfehler ist es, die Qualität einer Entscheidung nie anhand ihrer Auswirkung oder am Resultat zu bemessen. Sondern stets an der Qualität des Prozesses, der zur Entscheidung oder zur Handlung führte. So gesehen wäre es korrekt, wenn Manager, die mit dem Eingehen von zu viel Risiko hohe Gewinne gemacht haben, diese aber nur dem Glück verdanken können, von ihren Vorgesetzten sanktioniert würden. Weil wir aber dem Rückschau- und Ergebnisfehler unterliegen, neigen wir dazu, solchen Managern ein Gespür für den Erfolg beizumessen. All jene, die an glückverwöhnten Momentan-Lichtgestalten zweifeln, werden im Lichte des Erfolgs, den sie für sich reklamieren, als mittelmässig, zaghaft und schwach abgestempelt. Diese Reflexion veranschaulicht uns die Hartnäckigkeit des Rückschau- und Ergebnisfehlers. Als Führungskräfte sind wir gefordert, ihm mit einer konsequenten Selbstführung zu begegnen. Wer sich aufmacht, eine Sicherheitskultur im Unternehmen zu verankern, ist aufgefordert, bei sich selbst zu beginnen.
Note
Diese Aufforderung richtet sich nicht nur an Führungskräfte, sondern im besonderen Masse an (Staats-)Anwälte und Richter. Sie sind immer in der Position des Rückschauenden. Der Rückschaufehler hilft der klagenden Partei, eine kohärente Geschichte zu präsentieren, die mit der Realität nur bedingt oder gar nicht übereinstimmen muss. Der Effekt des «Es war (in Anbetracht des Schadens) offensichtlich, dass der Angeklagte ein zu grosses Risiko eingegangen ist» wirkt bei der urteilenden Öffentlichkeit wie auch bei vielen Richtern grossartig. Gut zu wissen, dass es zunehmend Richterinnen und Richter gibt, die dieser perfiden Wahrnehmungsverzerrung erfolgreich widerstehen können. Schwierig für die Richter hingegen ist der Umstand, dass das Strafrecht nicht die Handlungsabläufe und Entscheidungsprozesse, die zum Schaden führten, primär im Fokus hat, sondern die Schadengrösse. Es wäre an der Zeit, dass unsere Gesetzgeber hier für einen Ausgleich der zwei Orientierungen sorgen würden.